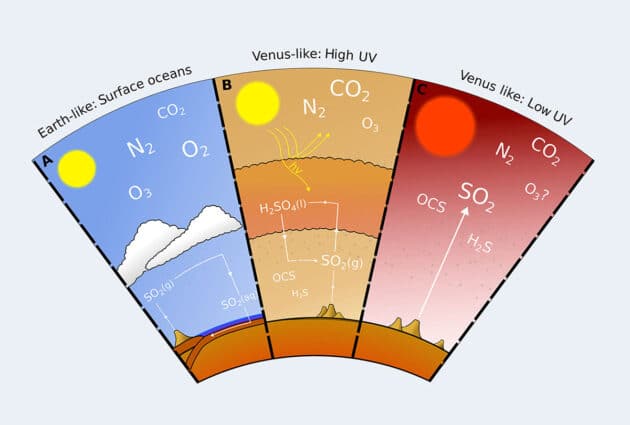Alternative Fakten: Psychologische Grundlagen einer postfaktischen Diskussionskultur

Symbolbild: Information.
Copyright: CC0 Creative Commons
Berlin (Deutschland) – Psychologen der Universitäten Koblenz-Landau und Marburg haben untersucht, wann Menschen besonders empfänglich dafür sind, an alternative Fakten zu glauben. In einer Reihe von Experimenten analysierten sie den Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen, situativen Einflüssen und der Bewertung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die zentralen Ergebnisse wurden jetzt in der „Psychologischen Rundschau“ veröffentlicht.
– Bei dieser Meldung handelt es sich um eine Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für Psychologie
2016 wurde der Begriff „post-truth“ vom Verlag Oxford Dictionaries zum Wort des Jahres gewählt. Im selben Jahr verwendete Angela Merkel in Deutschland das Wort „postfaktisch“, um eine politische Diskussionskultur zu beschreiben, in der die Bedeutung von Fakten hinter der von Emotionen und gefühlten Wahrheiten zurücktritt. Wie kommt es dazu, dass Menschen sich dafür entscheiden, bestimmten Informationen als „Wahrheiten“ Glauben zu schenken und andere Informationen zu ignorieren? Wie können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Erkenntnisse so kommunizieren, dass sie auch Zweifelnde erreichen?
www.grenzwissenschaft-aktuell.de
+ HIER können Sie den täglichen kostenlosen GreWi-Newsletter bestellen +
Das hat eine Forschergruppe um die Sozialpsychologen Tobias Rothmund und Mario Gollwitzer über einen Zeitraum von vier Jahren im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms „Wissenschaft und Öffentlichkeit“ untersucht. Die Forscher haben drei zentrale Erkenntnisse gewonnen: Erstens bewerten Menschen Fakten selten unvoreingenommen, sondern vor dem Hintergrund individueller Ziele, Bedürfnisse oder motivationaler Zustände. „Dabei ist es Menschen jedoch wichtig, ihre eigenen Bewertungsprozesse als vernunftgeleitet wahrzunehmen“ sagt Tobias Rothmund, Juniorprofessor für Politische Psychologie an der Universität Koblenz-Landau.
Persönliche Motivlagen beeinflussen die Bewertung von Fakten
Die Forscher konnten zeigen, dass Menschen hierzu in der Regel einer asymmetrischen Strategie der Informationsverarbeitung folgen: Argumente, die im Einklang mit persönlichen Motivlagen stehen, werden sehr leicht akzeptiert. Argumente, die persönlichen Motivlagen widersprechen, werden hingegen sehr kritisch geprüft. Es wird gezielt nach vermeintlichen Widersprüchen oder Mängeln in der Methodik, Argumentationslogik oder der Reputation der wissenschaftlichen Quellen gesucht.
Ein prominentes Beispiel hierfür ist der durch Menschen verursachte Klimawandel. In den USA zeigte sich in der öffentlichen Diskussion, dass Konservative die Existenz eines durch Menschen verursachten Klimawandels stärker leugnen als liberale US-Amerikaner/innen. Diese Unterschiede werden darauf zurückgeführt, dass Konservative stärker daran glauben wollen, dass es den Klimawandel nicht gibt – weil sie die damit einhergehenden veränderten Lebensbedingungen als bedrohlicher wahrnehmen. „Diese motivationale Ausgangslage fördert eine erhöhte Skepsis gegenüber wissenschaftlichen Belegen für den Klimawandel und eine asymmetrische Verarbeitung von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu diesem Thema“, erklärt Mario Gollwitzer, Professor für Methodenlehre und Sozialpsychologie an der Philipps-Universität Marburg.
Zum Thema
Die zweite Erkenntnis der Sozialpsychologen: Menschen neigen dann in besonderem Maße zu diesen asymmetrischen Bewertungen, wenn sie starke Überzeugungen oder Sorgen mit einem Thema verbinden. „Das ist besonders dann relevant, wenn sensible Personengruppen identifiziert und angesprochen werden sollen, wie zum Beispiel Eltern in der Diskussion um die Schädlichkeit frühkindlicher Impfungen oder passionierte Videospieler bei der Forschung zur Wirkung von Videospielgewalt“, sagt Mario Gollwitzer.
Kommunikation von Fakten: das „Wie“ ist entscheidend
„Unsere dritte Erkenntnis ist sowohl für den politischen Kontext als auch für die Kommunikation wissenschaftlicher Ergebnisse wichtig“, sagt Tobias Rothmund. „Je nachdem, wie Fakten kommuniziert werden, können diese asymmetrischen Verarbeitungsprozesse entweder verstärkt oder abgeschwächt werden.“
Konkret zeigen die Studien: Wenn Versuchspersonen in ihrer persönlichen oder sozialen Identität bestärkt werden, sind sie eher dazu bereit, Fakten zu akzeptieren, die eigentlich ihren Motivlagen widersprechen. Passionierte Videospieler waren zum Beispiel weniger kritisch gegenüber Befunden zur Schädlichkeit von Mediengewalt, wenn ihnen als Gruppe zuvor besondere Kompetenzen zugesprochen wurden – und so ihr Bedürfnis nach einer positiven sozialen Identität bekräftigt wurde. In den USA zeigte sich, dass Gegner des Klimawandels offener für kritische Befunde waren, wenn eine umweltbewusste Einstellung als patriotisch kommuniziert wurde. Mario Gollwitzer folgert daraus: „Wissenschaftskommunikation kann gelingen, indem ein kritischer Austausch auf Augenhöhe stattfindet und persönliche oder soziale Stigmatisierungen von Gruppen aktiv vermieden werden.“
© DGPS