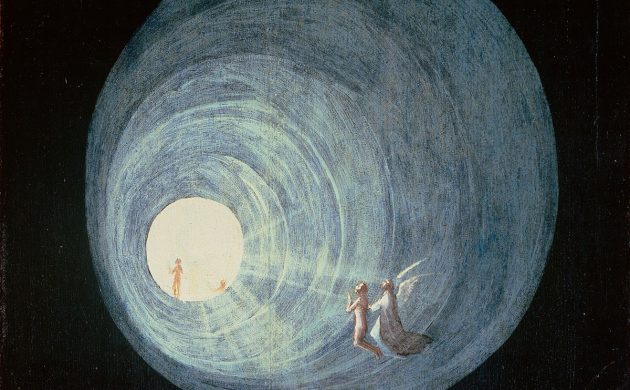Erstmals Orang-Utan bei Wundbehandlung mit Heilpflanzen beobachtet

Copyright: Saidi Agam / Suaq Project
Konstanz (Deutschland) – Verhaltensbiologen haben erstmals eine gezielte medizinische Wundbehandlung bei einem Wildtier mit Heilpflanzen beobachtet. Die Behandlung von Wunden könnte folglich schon beim letzten gemeinsamen Vorfahren von Mensch und Orang-Utan üblich gewesen sein.
Wie Forschende um Isabelle Laumer und Caroline Schuppli vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie, Konstanz und der Universitas Nasional in Indonesien aktuell im Nature-Fachjournal „Scientific Reports“ (DOI: 10.1038/s41598-024-58988-7) berichten, haben sie am Regenwald-Forschungsstandort Suaq Balimbing den männlichen Sumatra Orang-Utan Rakus beobachtet, der eine Gesichtswunde erlitten hatte. Dieser aß und trug wiederholt mehrere Minuten lang den Pflanzensaft einer Kletterpflanze mit nachgewiesenen entzündungshemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften auf die offene Wunde auf. Zum Schluss bedeckte er die gesamte Wunde mit dem zerkauten Pflanzenbrei. Nach wenigen Tagen war die zuvor klaffende Wunde nahezu spurlos verheilt. Wie die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen weiter berichten, werde die Pflanze tatsächlich auch in der traditionellen Medizin verwendet.
Hintergrund
Obwohl bei Tieren Krankheits- und Vermeidungsverhalten häufig beobachtet werden kann, ist Selbstmedikation durch Verzehr bestimmter Pflanzenteile bei Tieren weit verbreitet, kommt aber eher selten vor. Es ist bekannt, dass Menschenaffen bestimmte Pflanzen zur Behandlung von Parasiteninfektionen zu sich nehmen und Pflanzenmaterial auf ihre Haut reiben, um Muskelschmerzen zu lindern. Kürzlich wurde in Gabun beobachtet, wie eine Schimpansengruppe Insekten auf Wunden auftrug. Die Wirksamkeit dieses Verhaltens ist jedoch noch unbekannt. Bisher wurde eine aktive Wundbehandlung mit einer biologisch aktiven Substanz bei wilden Tieren noch nicht dokumentiert. (Quelle: AB.MPG)
„Drei Tage nach seiner Verletzung riss Rakus selektiv Blätter einer Liane mit dem gebräuchlichen Namen Akar Kuning (Fibraurea tinctoria) ab, kaute darauf und trug den resultierenden Saft dann mehrere Minuten lang immer wieder auf die Gesichtswunde auf. Als letzten Schritt bedeckte er die Wunde vollständig mit den zerkauten Blättern“, so Isabelle Laumer. „Diese und verwandte Lianenarten kommen in tropischen Wäldern Südostasiens vor, sind für ihre schmerzstillende und fiebersenkende Wirkung bekannt und werden in der traditionellen Medizin zur Behandlung verschiedener Krankheiten wie Malaria eingesetzt.“
Eine chemische Analyse der von Rakus verwendeten Pflanzenart belegte das Vorhandensein von Furano-Diterpenoide und Protoberberin-Alkaloiden mit antibakterieller, entzündungshemmenden, antimykotischen, antioxidativen und weiteren biologischen wundheilenden Eigenschaften.

Copyright: Armas / Suaq Project
Tatsächlich konnten die Forschenden in den folgenden Tagen anhand weiterer Beobachtungen keine Anzeichen einer Wundinfektion feststellen und nach fünf Tagen war die Wunde bereits geschlossen. „Interessanterweise ruhte Rakus auch mehr als sonst, als er verletzt war. Schlaf wirkt sich positiv auf die Wundheilung aus, da die Freisetzung von Wachstumshormonen, die Proteinsynthese und die Zellteilung im Schlaf gesteigert ist“, erklärt Laumer.
www.grenzwissenschaft-aktuell.de
+ HIER können Sie den täglichen und kostenlosen GreWi-Newsletter bestellen +
Wie jedes Selbstmedikationsverhalten bei Tieren, so werfe auch dieser Fall die Frage auf, wie beabsichtigt diese Verhaltensweisen sind und wie sie entstehen: „Das Verhalten von Rakus schien absichtlich zu sein, da er nur seine Gesichtswunde an seinem rechten Backenwulst mit dem Pflanzensaft behandelte und keine anderen Körperteile. Das Verhalten wurde mehrmals wiederholt, und dabei nicht nur der Pflanzensaft, sondern später auch das zerkaute Pflanzenmaterial aufgetragen, bis die Wunde vollständig bedeckt war und der gesamte Vorgang nahm eine beträchtliche Zeit in Anspruch“, erläutert Laumer. „Es ist möglich, dass die Wundbehandlung mit Fibraurea tinctoria, die von den Orang-Utans in Suaq selten gefressen wird, eine individuelle Erfindung darstellt“, fügt Caroline Schuppli hinzu. „Einzelne Tiere können versehentlich ihre Wunden berühren, während sie von dieser Pflanze fressen, und so unbeabsichtigt den Saft der Pflanze auf ihre Wunden auftragen. Da Fibraurea tinctoria eine starke analgetische Wirkung hat, können die Tiere eine sofortige Schmerzlinderung verspüren, was dazu führt, dass sie das Verhalten mehrmals wiederholen.“
Hintergrund: Medizin im Tierreich
Schon 2011 beschrieb der Biologe Benjamin Hart von der University of California die vielfachen Parallelen zwischen menschlicher und tierischer Medizin und stellte fest, dass es „für jedes der vier Grundprinzipien der menschlichen Medizin Beispiele im Tierreich“ gibt. Als Beispiele nennt Hart den Verzehr antimikrobiell wirkender Heilpflanzen oder das Verwenden antiparasitär wirkender Pflanzen beim Nestbau. Die Pflege kranker Artgenossen könne beispielsweise bei Affen und Elefanten beobachtet werden. Während zwar nur der Mensch verschiedene medizinische Strategien zu einem fortgeschrittenen System kombiniert habe, gehe dieses System jedoch auf Strategien zurück, die Teil eines „instinktiven Erbes“ seien, „das wir mit dem Rest des Tierreichs teilen“, so Hart in seinem damaligen Artikel im Fachjournal „Philosophical Transactions of the Royal Society B“ (DOI: 10.1098/rstb.2011.0092).
Da das Verhalten bisher jedoch noch nie beobachtet wurde, ist die Wundbehandlung mit Fibraurea tinctoria möglicherweise bislang im Verhaltensrepertoire der Suaq-Orang-Utan-Population nicht vorhanden. Wie alle erwachsenen Männchen in der Gegend wurde Rakus nicht in Suaq geboren, seine Herkunft ist unbekannt. „Orang-Utan Männchen verlassen ihr Geburtsgebiet während oder nach der Pubertät und wandern über weite Strecken, um entweder in einem anderen Gebiet ein neues Revier zu besetzen oder bewegen sich zwischen den Revieren anderer“, erklärt Schuppli weiter. Daher sei es möglich, dass sich auch andere Orang-Utans in seiner Geburtspopulation außerhalb des Suaq-Forschungsgebiets so verhalten.
Die erstmalige Beobachtung liefert nun neue Einblicke zum Selbstmedikationsverhalten bei unseren nächsten Verwandten und in die evolutionären Ursprünge der Wundmedikation. „Die Behandlung menschlicher Wunden wurde höchstwahrscheinlich erstmals in einem medizinischen Manuskript aus dem Jahr 2200 v. Chr. erwähnt, das das Reinigen, Pflastern und Verbinden von Wunden mit bestimmten Wundpflegemitteln umfasste“, so Schuppli. „Da Formen der aktiven Wundbehandlung nicht nur beim Menschen, sondern auch bei afrikanischen und asiatischen Menschenaffen vorkommen, ist es möglich, dass es einen gemeinsamen zugrunde liegenden Mechanismus für die Erkennung und Anwendung von Substanzen mit medizinischen oder funktionellen Eigenschaften auf Wunden gibt und dass unser letzter gemeinsamer Vorfahre bereits ähnliche Formen des Wundpflegeverhaltens zeigte.“
WEITERE MELDUNGEN ZUM THEMA
Studie zeigt: Ameisen pflegen verwundete Artgenossen 14. Februar 2018
Recherchequelle: MPG
© grenzwissenschaft-aktuell.de