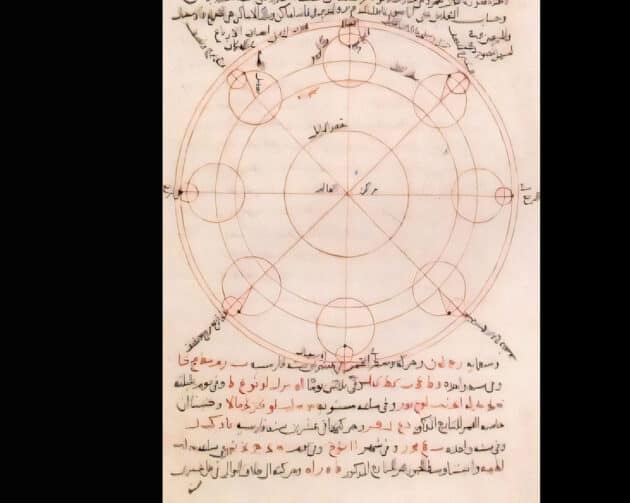Paläontologen finden Gesicht der ersten Europäer

Copyright: Maria D. Guillén / IPHES-CERCA
Inhalt
Tarragona (Spanien) – Der Fund von Fragmenten der Gesichtspartie eines früh-menschlichen Schädels an der Fundstätte Sima del Elefante in Nordspanien schreibt die Geschichte der ersten Besiedlung Europas neu.
Das 2022 in der Sierra de Atapuerca, Burgos entdeckte und zusammengefügten Gesichtsfossilfragment wurde aktuell auf ein Alter von 1,1 bis 1,4 Millionen Jahren datiert und ist somit das älteste bekannte Gesicht Westeuropas.
Neue Erkenntnisse über erste Migration und Evolution in Europa
Wie das Team unter der Leitung von Dr. Rosa Huguet vom Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA) und assoziierte Professorin an der Universität Rovira i Virgili (URV) aktuell im Fachjournal „Nature“ (DOI: 10.1038/s41586-025-08681-0) berichtet, wurde das Gesichtsfragment mit der Bezeichnung „ATE7-1“ („Pink“) dem Homo affinis erectus zugeordnet und stellt ein Schlüsselelement für das Verständnis der ersten Migrationen und der Evolution der Homininen auf dem europäischen Kontinent während des frühen Pleistozäns dar. Zuvor war das Fossil einer anderen Art, dem Homo antecessor zugeordnet worden – fälschlicherweise, die in der Fundstätte Gran Dolina identifiziert wurde.
Bei dem Fund handelt es sich um Fragmente der linken Gesichtshälfte eines erwachsenen Individuums in der Schicht TE7 der Sima del Elefante. Diese Fragmente erforderten aufwendige Rekonstruktionsarbeiten mithilfe traditioneller Konservierungs- und Restaurierungstechniken sowie moderner Bildgebung und 3D-Analyse.
„Homo antecessor weist mit Homo sapiens ein moderneres Gesichtsprofil und eine ausgeprägte Nasenstruktur auf, während das Gesicht von ‚Pink‘ primitiver ist, mit Merkmalen, die an Homo erectus erinnern, insbesondere die flache und wenig entwickelte Nasenstruktur“, erläutert Dr. María Martinón-Torres, Direktorin des CENIEH und eine der Hauptforscherinnen des Atapuerca-Forschungsprojekts.
Zugleich betont die Wissenschaftlerin aber auch, dass die Beweislage noch für eine endgültige Klassifikation noch nicht ausreiche, weshalb die Zuordnung zu H. aff. erectus vorläufig bleibe. „Diese Bezeichnung erkennt die Ähnlichkeiten von Pink mit Homo erectus an, lässt aber offen, dass es sich möglicherweise um eine andere Art handelt.“
Mit einem Alter von 1,1 bis 1,4 Millionen Jahren ist das Fossil deutlich älter als die Überreste von Homo antecessor, die auf etwa 860.000 Jahre geschätzt werden. „Diese Chronologie legt nahe, dass ‚Pink‘ zu einer Population gehörte, die Europa in einer früheren Migrationswelle als Homo antecessor erreichte“, so die Forscherinnen und Forscher.
Rückschlüsse auf Lebensweise und Umwelt im Pleistozän
Aus der Schicht (TE7 der Sima del Elefante), in der ATE7-1 gefunden wurde, lassen sich zahlreiche Schlüsse auf die Lebensweise der Frühmenschenart ableiten. So finden sich darin zahlreiche Beweise nicht nur für deren Präsenz, sondern für deren Aktivitäten während des frühen Pleistozäns. Dazu gehören Steinwerkzeuge und Tierknochen mit Schnittspuren, die auf die Nutzung von Steinwerkzeugen zur Fleischverarbeitung hinweisen.

Copyright/Quelle: Nature / Maria D. Guillén / IPHES
„Die gefundenen Quarz- und Feuersteinwerkzeuge sind zwar einfach, zeigen aber eine effektive Überlebensstrategie und belegen die Fähigkeit dieser Homininen, ihre Umweltressourcen zu nutzen“, erläutert Dr. Xosé Pedro Rodríguez-Álvarez, Spezialist für Steinzeit-Industrie, die Funde. „Diese Praktiken zeigen, dass die ersten Europäer mit den verfügbaren tierischen Ressourcen vertraut waren und sie systematisch nutzten“, ergänzt Dr. Rosa Huguet, Spezialistin für Taphonomie.
Die paläoökologischen Daten aus Schicht TE7 lassen auch Rückschlüsse auf den Lebensraum und die Landschaft des frühen Pleistozäns in der Sierra de Atapuerca zu, die offenbar aus einer Mischung aus bewaldeten Gebieten, feuchten Wiesen und saisonalen Wasserquellen bestand und so den frühen menschlichen Bewohnern zahlreiche Ressourcen bot.
Laut dem Forschungsteam stellt die Entdeckung von ATE7-1 einen weiteren bedeutenden Fortschritt für das Atapuerca-Projekt und die Erforschung der menschlichen Besiedlung Europas dar. „Diese Fundstätte ist entscheidend für das Verständnis unserer Ursprünge, und der neue Fund bestätigt die Rolle von Atapuerca als weltweites Zentrum der menschlichen Evolutionsforschung“, so Dr. Marina Mosquera, Direktorin des IPHES-CERCA und eine der Hauptforscherinnen des Atapuerca-Projekts.
Neues Bild von sehr alten Europa
Das Fossil erweitere nicht nur unser Wissen über die ersten Bewohner Europas, sondern wirft auch neue Fragen über die Herkunft und Vielfalt der Homininen auf, die den Kontinent bewohnten. „Die Tatsache, dass wir Beweise für verschiedene Homininenpopulationen im westlichen Europa während des frühen Pleistozäns finden, deutet darauf hin, dass dieses Gebiet eine Schlüsselregion in der evolutionären Geschichte der Gattung Homo war“, erläutert Dr. Eudald Carbonell, Co-Direktor des Atapuerca-Projekts.
Zukünftige Entdeckung und deren Analysen könnten dabei helfen, den Ursprung und die Dynamik der ersten menschlichen Besiedlung Europas noch präziser zu bestimmen und könnte so weitere Erkenntnisse über die Migrationswellen liefern, die die Menschheitsgeschichte geprägt haben.
WEITERE MELDUNGEN ZUM THEMA
Frühmenschen kamen 500.000 Jahre früher nach Europa 23. Januar 2025
Sensationsfunde in Südafrika: Schon Frühmensch Homi naledi begrub seine Toten und verzierte Wände der Grabhöhle mit Symbolen 13. Juni 2023
Homo naledi: Nutze bereits Frühmenschenart Werkzeuge und Feuer? 4. Dezember 2022
Recherchequelle: Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA)
© grenzwissenschaft-aktuell.de