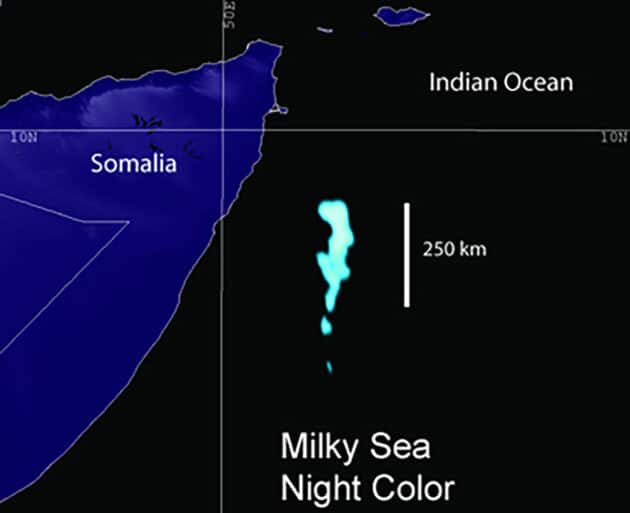Studie weckt Zweifel an Biomarker-Nachweis auf Exoplanet K2-18b
Oxford (Großbritannien) – Die Nachricht über eine Bestätigung der Detektion des Biomarkers Dimethylsulfid (DMS) – einem Molekül, das auf der Erde ausschließlich von Organismen erzeugt wird – hat vergangenen Woche weltweit für Aufsehen und Schlagzeilen gesorgt. Eine neue Studie weckt nun jedoch Zweifel am bislang „besten Hinweis auf außerirdisches Leben“.

Copyright/Quelle: A. Smith/N. Mandhusudhan
Inhalt
Zuvor hatte das Team um Nikku Madhusudhan von der University of Cambridge im Fachjournal „The Astrophysical Journal Letters“ (DOI: 10.3847/2041-8213/adc1c8) berichtet, dass sie frühere DMS-Detektionen mit den Instrumenten NIRISS und NIRSpec an Bord des Webb-Weltraumteleskops von 2023 (…GreWi berichtete) nun auch mit einem weiteren, unabhängigen Instrument des Webb-Teleskops, dem „Mid-Infrared Instrument“ (MIRI) im mittleren Infrarotbereich bestätigen konnten und somit die Signifikanz des Nachweises des Biomoleküls das statistische Niveau von 3 Sigma überschritten habe.
Erste Detektionen
Auf der Erde werden die von Madhusudhan, Kolleginnen und Kollegen ermittelten Moleküle DMS und DMDS (Dimethyldisulfid) ausschließlich von Leben erzeugt, hauptsächlich von mikrobiellen Lebensformen wie marinem Phytoplankton. Auch wenn ein bislang unbekannter chemischer Prozess die Quelle dieser Moleküle in der Atmosphäre von K2-18b sein könnte, stellen die veröffentlichten Ergebnisse dennoch den bislang stärksten Hinweis darauf dar, dass Leben auf einem Planeten außerhalb unseres Sonnensystems existieren könnte.
K2-18b
Entdeckt wurde der ferne Planet „K2-18b“ 2015 in gerade einmal 124 Lichtjahre Entfernung im Sternbild Löwe. 2023 folgte dann die erste Detektion von Kohlendioxid, Methan und Dimethylsulfid in der Atmosphäre des Planeten. Der Nachweis von Methan und Kohlendioxid sowie kleinen Mengen an Ammoniak in der Atmosphäre von K2-18b unterstrich bereits damals die Hypothese, wonach der Planet eine wasserstoffreiche Atmosphäre und einen globalen Ozean besitzen könnte. Zudem umkreist der Planet seinen Stern innerhalb dessen habitabler, also potenziell lebensfreundlicher Zone – jener Abstandsregion also, innerhalb derer ein Planet seinen Stern umkreisen muss, damit aufgrund gemäßigter Temperaturen auf seiner Oberfläche flüssiges Wasser (und damit die Grundlage des zumindest uns bislang bekannten Lebens) existieren kann. Frühere Beobachtungen des Planeten legen nahe, dass „K2-18b“ 8,6-mal so massereich und 2,6-mal so groß wie die Erde ist. Die ersten Detektionen von Methan und Kohlendioxid in seiner Atmosphäre stellten den ersten Nachweis kohlenstoffbasierter Moleküle in der Atmosphäre eines Exoplaneten in der habitablen und damit potenziell lebensfreundlichen Zone dar. Die Werte entsprachen den Vorhersagen für einen sogenannten „Hycean“-Planeten, also eine lebensfreundliche, gänzlich von einem Ozean bedeckte Welt unter einer wasserstoffreichen Atmosphäre.

Zweifel an der Deutung der Messwerte
Nach dem ersten Jubel um die neuen Messungen, mischt sich nun jedoch auch fundierte Kritik an Zweifel an deren Deutung in die wissenschaftliche Debatte: In einer vorab via ArXiv.org veröffentlichten Analyse der Daten, stellt Dr. Jake Taylor vom Department of Physics an der Universität Oxford die Ergebnisse infrage. Im Gegensatz zu Mahudusans Team sieht Taylor keine starke statistische Evidenz für das Vorhandensein von DMS oder anderen Biosignatur-Gasen auf Basis der MIRI/LRS-Transmissions-Spektroskopie des Webb-Teleskops: „Trotz der Behauptung einer 3,4-Sigma-Abweichung von einer flachen [Null-Detektion] Linie, sehe ich, dass gerade auch eine solche flache Linie eine akzeptable Anpassung darstellt.“
www.grenzwissenschaft-aktuell.de
+ HIER den täglichen kostenlosen GreWi-Newsletter bestellen +
Durch eine Analyse mithilfe von Gaußschen Funktionen untersuchte Taylor das Spektrum auf signifikante Absorptionsmerkmale, die auf Moleküle in der Atmosphäre hinweisen könnten. In fünf von sechs Tests habe sich gezeigt, dass die Daten sogar besser durch ein flaches Spektrum als durch eines mit molekularen Merkmalen erklärt werden konnten, so der Wissenschaftler. Selbst bei gezielten Tests an Wellenlängen, an denen DMS und ähnliche Verbindungen zu erwarten wären, will Taylor nur eine schwache statistische Unterstützung – entsprechend einer 2-Sigma-Detektion – gefunden haben, was unter der in der Astrophysik üblichen Schwelle für belastbare Nachweise liegt. „Daher sehe ich keine starken Belege für detektierte spektrale Merkmale im MIRI-Transmissionsspektrum von K2-18b.“
Ein DMS-Schimmer bleibt
Allerdings will auch Taylor das Vorhandensein von DMS oder ähnlichen Verbindungen in der Atmosphäre von K2-18b nicht vollständig ausschließen und erklärt hinzu: „Nur wenn ich die Gaußschen Funktionen auf spezifische Wellenlängen fixiere, sehe ich eine Abweichung von einer flachen Linie“. Seine Arbeit unterstreiche jedoch die Notwendigkeit zur Vorsicht beim Umgang mit den Daten, denn: „Neutralere, modellunabhängige Ansätze hingegen ergaben Spektren, die keinerlei atmosphärische Merkmale aufwiesen.“
Während Taylors Analyse bislang noch nicht von anderen Wissenschaftlern expertenbegutachtet und ordentlich publiziert wurde, dürfte dies nicht lang auf sich warten lassen und die Debatte um mögliches Leben auf K2-18b erneut anfachen.
WEITERE MELDUNGEN ZUM THEMA
K2-18b: Messungen mit Webb-Weltraumteleskop bestätigen stärkste Anzeichen für außerirdisches Leben 17. April 2025
Zweifel an Biomarker DMS auf Exoplanet K2-18b 6. Mai 2024
Biomarker: Webb-Weltraumteleskop entdeckt Kohlendioxid, Methan und Dimethylsulfid in der Atmosphäre der Super-Erde K2-18b 12. September 2023
K2-18b: Ferner Exoplanet könnte lebensfreundliche Super-Erde sein 6. Dezember 2017
Recherchequelle: ArXiv.org
© grenzwissenschaft-aktuell.de