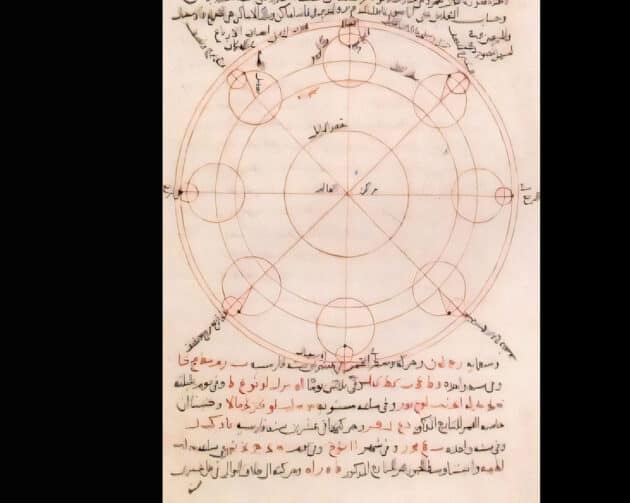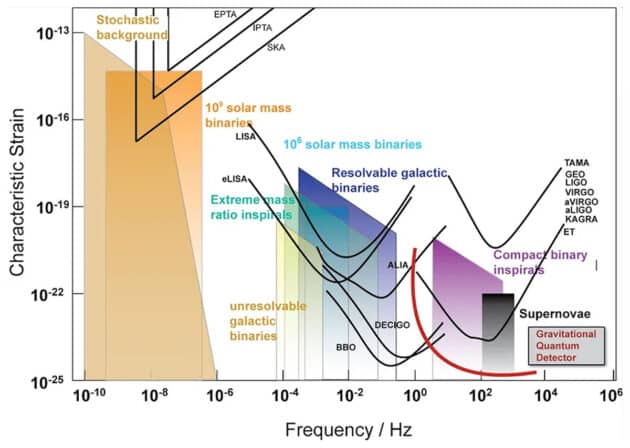Suche nach Leben auf Exoplaneten: Auch wenn man nichts findet, findet man etwas
Zürich (Schweiz) – Die Suche nach außerirdischem Leben gehört derzeit zu den großen Zielen der Astronomie und Weltraumforschung. Doch was würde es bedeuten, wenn bei all der Suche keine Anzeichen dafür gefunden würden. Eine aktuelle Studie hat sich dieser Frage angenommen.

Copyright: ESO/S. Brunier
Inhalt
Wie das Forschungsteam unter Leitung von Dr. Daniel Angerhausen von der ETH Zürich aktuell im „The Astronomical Journal“ (DOI: 10.3847/1538-3881/adb96d) berichtet, stand die Studie unter der Frage, welche Folgerungen sich ein potenzielles Null-Ergebnis – also das Ausbleiben von Beweisen und Belegen für außerirdischen Leben – über die Verbreitung von Leben im Universum ableiten ließen?
Erkenntnisse auch ohne Nachweis von Leben
Für ihre Studie nutzen die Forschenden bayesianische Statistik, um zu berechnen, wie viele Exoplaneten untersucht werden müssten, um verlässliche Aussagen über die Häufigkeit bewohnter Welten zu treffen – selbst dann, wenn kein Leben gefunden wird.
Das Ergebnis: Würden bei der Analyse von 40 bis 80 Exoplaneten keinerlei Hinweise auf Leben entdeckt, ließe sich mit hoher statistischer Sicherheit sagen, dass weniger als 10 bis 20 % ähnlicher Planeten Leben beherbergen. Auf die Milchstraße übertragen, entspräche das immer noch bis zu 10 Milliarden potenziell bewohnbarer Planeten. Und schon das wäre laut den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ein bedeutender Erkenntnisgewinn.
www.grenzwissenschaft-aktuell.de
+ HIER den täglichen kostenlosen GreWi-Newsletter bestellen +
Unsicherheiten beeinflussen Ergebnisse
Allerdings wäre ein solcher Befund nur dann aussagekräftig, wenn Unsicherheiten systematisch berücksichtigt werden. Die Studie nennt hier exemplarisch zwei Hauptquellen für Fehler:
– Interpretationsunsicherheiten: Lebenszeichen könnten übersehen werden – etwa wenn eine Biosignatur wie Sauerstoff oder Methan nicht erkannt wird (falsch-negatives Ergebnis).
– Stichprobenverzerrung: Werden Planeten untersucht, die gar nicht die nötigen Bedingungen für Leben erfüllen, kann dies die Ergebnisse verzerren.
„Es geht nicht nur darum, wie viele Planeten wir beobachten – sondern darum, die richtigen Fragen zu stellen und sicher zu sein, was wir tatsächlich sehen oder übersehen“, so Angershausen.
Bedeutung für die LIFE-Mission
Diese Erkenntnisse sind insbesondere für zukünftige Missionen wie das von der ETH Zürich geleitete Projekt „LIFE“ (Large Interferometer for Exoplanets) bedeutsam. Dieses hat zum Ziel, erdähnliche Exoplaneten in Bezug auf Masse, Radius und Temperatur zu untersuchen und insbesondere ihre Atmosphären auf Anzeichen von Wasser, Sauerstoff und komplexeren Biosignaturen hin zu untersuchen.
Laut Angerhausen ist das geplante Beobachtungsvolumen groß genug, um statistisch belastbare Rückschlüsse auf die Häufigkeit von Leben in unserer galaktischen Nachbarschaft zu ziehen. Dennoch betonen die Autoren, dass selbst bei modernsten Instrumenten eine präzise Erfassung von Unsicherheiten unverzichtbar ist.
Ein zentraler Vorschlag der Studie: Statt vager Fragen wie „Wie viele Planeten haben Leben?“, sollten konkret messbare Fragestellungen formuliert werden. Etwa die Frage danach, welcher Anteil von Gesteinsplaneten in habitablen Zonen deutliche Hinweise auf Wasserdampf, Sauerstoff oder Methan zeigt?
Zwei statistische Ansätze im Vergleich
Die Forschenden analysierten auch, wie Vorwissen (sogenannte Priors in der bayesianischen Statistik) die Ergebnisse beeinflussen könnte. Dazu verglichen sie den bayesianischen Ansatz mit der frequentistischen Statistik, die auf Vorannahmen verzichtet.
Emily Garvin, Mitautorin der Studie und Doktorandin an der ETH Zürich, zeigte, dass beide Methoden bei der geplanten Stichprobengröße zu ähnlichen Ergebnissen führen. „Bayes und Frequentismus werden oft als konkurrierende Denkschulen gesehen, aber sie liefern komplementäre Perspektiven, um Wahrscheinlichkeiten zu interpretieren“, so Garvin.
Die Kombination beider Herangehensweisen ermögliche eine robustere Datenanalyse – je nach Fragestellung könne eine Methode besser geeignet sein als die andere.
Fazit: Ein „Nichts“ ist nicht bedeutungslos
Die Untersuchung zeigt, dass auch ein Null-Ergebnis – also keine Lebenszeichen auf Exoplaneten – wissenschaftlich bedeutsam sein kann, weil es belastbare Aussagen über die Seltenheit oder Häufigkeit von Leben im Universum erlaubt.
„Ein einzelner positiver Nachweis würde alles verändern – aber selbst wenn wir kein Leben finden, können wir quantifizieren, wie selten – oder häufig – Planeten mit nachweisbaren Biosignaturen tatsächlich sein könnten“, so Angerhausen abschließend.
WEITERE MELDUNGEN ZUM THEMA
Biosignaturen: Riesenteleskop ELT könnte in kurzer Zeit außerirdisches Leben in Erdnähe finden 7. April 2025
Neue Studie sieht höhere Wahrscheinlichkeit für intelligentes Leben 17. Februar 2025
Recherchequelle: ETH Zürich, SETI Institute
© grenzwissenschaft-aktuell.de